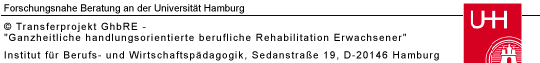Gestaltung handlungsorientierter Lernerfolgskontrollen
von Jochen Walter
Handlungsorientiertes Lernen zeichnet sich bekanntlich
durch einen hohen Grad an Selbstregulation und Autonomie im Lernvollzug
aus. Anspruchsvolle handlungsorientierte Lernarrangements sind häufig
so konzipiert,
- daß das Defiziterlebnis (bzw. der Lernanlaß),
das vielfache der Bildung von Lernzielen vorausgeht, nicht von außen
"vorgegeben", sondern vom Lerner authentisch erlebt wird,
- daß der Lerner seine Aktivitäten nicht auf ein von außen
eng vorgegebenes Lernziel ausrichtet, sondern sich auch selbst Ziele stecken
kann,
- daß er seine Handlungsplanung zur Bewältigung der Lernaufgabe
selbst erzeugt und seine Aktivitäten nicht an detailliert vorgegebenen
Anweisungen oder Aufgaben ausrichten muß.
Zu einer anspruchsvollen Lernaufgabe gehört die selbständige
Kontrolle und Bewertung des Erreichten. Diese Erfolgskontrolle sollte
demnach
- hinsichtlich Art, Umfang und Zeitpunkt vom Lernenden selbst geplant
und nicht durch äußere Vorgaben bestimmt werden,
- sich nicht auf vorgegebene Fragen und Kriterien, sondern auf vom Lerner
selbst entwickelte Erfolgskriterien stützen,
- eine vom Lerner ggf. selbst vorgenommene Fehlersuch- und Fehlerkorrektur
umfassen
- und nicht durch eine äußere Instanz überwacht werden,
die bei Schwierigkeiten oder Fehlern von sich aus eingreift.
Grundlagen handlungsorientierter Lernerfolgskontrollen
Dies ist sicherlich eine idealtypische Beschreibung, der Lern- und Prüfungssituationen im Ausbildungsalltag nicht immer gerecht werden können. Allerdings stellen immer mehr Lehrer/innen und Ausbilder/innen die Frage, wie handlungsorientierte Lernprozesse durch entsprechend gestaltete Lernerfolgskontrollen (also Prüfungen und Beurteilungen) befördert werden können. Dazu ist es m. E. notwendig, sich von einem eng gefaßten Qualifikationsbegriff, der ausschließlich an fremdgesetzten Erfordernissen ausgerichtet ist, zu verabschieden, weil er sowohl die im Menschen angelegten Dispositionen für neue Handlungsverläufe als auch das autonome Handeln mit eigenen Zielsetzungen weitgehend ausblendet.
Daher wird von vielen Verfechtern einer handlungsorientierten Berufsbildung vorzugsweise der Kompetenzbegriff verwendet. Handlungskompetenz meint in diesem Zusammenhang die strukturierte Gesamtheit der von einem Individuum erworbenen Handlungsschemata, ergänzt durch die Fähigkeit, aus einer begrenzten Zahl individuell verfügbarer Handlungsschemata neue Handlungsfolgen aufzubauen. Bei der Bewältigung komplexer beruflicher Aufgaben kommt es nämlich darauf an, unterschiedliche Fähigkeiten flexibel zu kombinieren. Hierfür gibt es nur zum Teil personenunabhängige Handlungsschemata. Entscheidend ist vielmehr ein subjektives Potential, mit komplexen Situationen erfolgreich umzugehen, wobei die Erfolgskriterien selbst nur noch teilweise von außen beschrieben werden können, sondern gleichermaßen vom handelnden Subjekt (also in unserem Fall: dem Lernenden) mitdefiniert werden müssen. Lernerfolg darf deshalb nicht als möglichst exakte Übereinstimmung von fremdgesetztem Lernziel und fremdbewertetem Lernergebnis angesehen werden. Die Beurteilung eines Lernerfolgs ergibt sich vielmehr aus dem Spannungsfeld zwischen von außen gesetzten Anforderungen einerseits und den vom Lernenden interpretierten Erfolgskriterien andererseits.
Für "handlungsorientierte Leistungsbeurteilungen"
bedeutet dies zumindest folgendes:
- Der zur Beurteilende müßte
die Möglichkeit haben, im Rahmen des Leistungserbringungsprozesses
selbst Teilziele setzen und begründen zu können. Dies könnte
unter anderem eine Einflußnahme seinerseits auf die Gestaltung der
Aufgabenstellung, die der Leistungsbeurteilung zugrunde liegen soll, bedeuten.
Auch die Erfolgskriterien könnten vom Kandidaten im Rahmen der Bearbeitung
der Aufgabe entwickelt oder modifiziert werden.
- Die der Beurteilung
zugrundeliegende Aufgabe müßte eine "vollständige
Handlung" (idealtypisch: Informieren, Planen, Durchführen, Kontrollieren,
Bewerten) beinhalten und in einem aktiv-konstruktiven Gestaltungsprozeß
zu bewältigen sein. Dies bedeutet u.a.: Nur so wenig Restriktionen
und Vorgaben hinsichtlich des Lösungsweges wie nötig und so
viel Freiräume zur selbständigen Gestaltung und Entwicklung
eigener Lösungsstrategien wie möglich.
- Eine Reflexion und
Selbstbewertung des zu Beurteilenden muß gegeben sein. Dies kann
z.B. dadurch geschehen, daß eine vom Beurteilten vorgenommene Qualitätskontrolle
sich nicht nur auf das Arbeitsprodukt, sondern auch auf den Planungs-
und Arbeitsprozeß bezieht. Die dabei zutage tretenden subjektiven
Interpretationen sind bei der Fremdbeurteilung unbedingt zu berücksichtigen.
Also: der zu Beurteilende ist - zumindest indirekt - in den Bewertungsprozeß
einzubeziehen (z.B. durch ein "Expertengespräch" über
das erstellte Arbeitsprodukt o.ä.).
Praktische Beispiele für handlungsorientierte Lernerfolgskontrollen
Wie können diese Forderungen im Ausbildungsalltag praktisch umgesetzt werden? Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:
Die Projektaufgabe
Eine Gruppe von Auszubildenden soll eine komplexe Projektarbeit bewältigen. Entsprechend ihrem Ausbildungsstand sowie den vorhandenen (technischen u.s.w.) Möglichkeiten erörtern die Auszubildenden mit Beratung durch ihren Ausbilder mögliche Aufgabenstellungen, definieren dann jedoch ihr Vorhaben selbst (bspw. die Programmierung und Inbetriebnahme eines Transport- und Handhabungssystems; oder die Anfertigung eines Schaltschranks). Nachdem die Aufgabe durch die beteiligten Auszubildenden konkretisiert und analysiert worden ist, legen sie mit ihrem Ausbilder gemeinsam Erfolgskriterien sowohl bezüglich der Güte des Arbeitsergebnisses als auch bezüglich der Vorgehensweise fest. Währende der Projektarbeit beobachtet und berät (auf Anfrage) der Ausbilder die Auszubildenden regelmäßig. Nach Beendigung ihrer Arbeit präsentieren die Auszubildenden das Arbeitsergebnis und bewerten es gemeinsam mit dem Ausbilder. Außerdem beratschlagen sie über Stärken und Schwächen der Vorgehensweise und Arbeitsaufteilung. Auf Wunsch der Auszubildenden oder des Ausbilders werden ggf. auch die Beiträge der einzelnen Auszubildenden begutachtet. Sämtliche Beurteilungen richten sich nach den anfangs vereinbarten Erfolgskriterien, wobei es sein kann, daß diese im Lichte neu gesammelter Erfahrungen teilweise revidiert werden müssen.
Die Praxisaufgabe
Im Gegensatz zur Theorieklausur in der Berufsschule, die i. d. R. aus schriftlichen Fragen und Aufgaben besteht und zumeist striktes Kommunikationsverbot zwischen den Berufsschülern beinhaltet, soll die Praxisaufgabe (man könnte auch Praxisklausur sagen): - eine für die Schüler neue Konstruktionsaufgabe enthalten, - auf Gruppenarbeit (zwei bis drei Schüler/innen) beruhen. Die Schüler erhalten eine - etwa einen ganzen Schultag umfassende - vorgegebene Konstruktionsaufgabe mit entsprechenden Informationen zu den ebenfalls vorgegebenen Rahmenbedingungen. Je nach Berufsfeld kann dies z. B. sein: Planung einer größeren Geschäftsreise; Erstellung eines komplexen Angebots; Entwicklung, Aufbau und Test einer elektrischen Schaltung; Planung, Konstruktion und Anfertigung einer kleineren Vorrichtung; u.s.w.. Im Rahmen der Praxisaufgabe bzw. -klausur werden - je nach zugrundeliegender Kontruktionsaufgabe - ein Arbeitsplan, das Arbeitsergebnis selbst sowie ein Untersuchungsbericht (auch Konstruktions- oder Arbeitsbericht genannt) bewertet. Während Arbeitsplan und Arbeitsergebnis als Gruppenleistung bewertet werden, ist der Untersuchungsbericht von jedem Gruppenmitglied anzufertigen, also eine Einzelleistung.
Die schriftliche Fallaufgabe
Im Rahmen einer schriftlichen Prüfung erhalten die Auszubildenden zu Beginn eine komplexe Aufgabenstellung bzw. einen grob umrissenen Fall, dessen Bearbeitung sich wie ein roter Faden durch alle Prüfungsfächer durchzieht. Bei bauzeichnerischen und bauhandwerklichen Berufen kann dies z.B. der Lageplan von einem Pkw-Stellplatz mit Gehweg und Rinne sein. Die Auszubildenden beginnen zunächst mit einer je eigenen zeichnerischen Lösung des vorgegebenen Lageplans (Prüfungsfach: Technisches Zeichnen). Ausgehend von ihrer persönlichen Lösung wählen sie geeignete Baustoffe u.s.w. aus und beantworten entsprechende Fragen (Prüfungsfach: Technologie). Daraufhin führen sie entsprechende Flächen-, Volumen- und Baustoffbedarfsrechnungen durch (Prüfungsfach: Technische Mathematik). Zuletzt unterziehen sie ihre Lösung einer abschließenden Bewertung nach teils vorgegebenen und teils selbst eingeführten Kriterien.
Die praktische Prüfungsaufgabe
Im Rahmen einer praktischen Prüfung schlägt der Auszubildende nach Beratung durch seinen Ausbilder und/oder Lehrer dem Prüfungsausschuß zwei praktische Aufgaben vor. Bei den metallverarbeitenden Berufen könnte dies z.B. die Erstellung eines komplexen Werkstücks nach Zeichnung sein. Der Vorschlag ist an bestimmte Vorgaben gebunden, z.B.: ein bestimmter Schwierigkeitsgrad ist einzuhalten, der zeitliche Umfang beträgt 3 Tage, bestimmte Arbeitsverfahren müssen vorkommen u.s.w.. Der Ausschuß wählt einen der beiden Vorschläge als Prüfungsaufgabe aus und legt dazu ggf. notwendige Modifikationen und Bedingungen fest. Die Erstellung des Werkstücks erfolgt nun selbständig durch den Auszubildenden. Die Aufgabenlösung (in unserem Fall das Werkstück) ist dem Prüfungsausschuß in einer Präsentation vorzustellen und bildet den Gegenstand eines "Fachgespräches". Dabei soll der Auszubildende seine Vorgehensweise begründen und ggf. Alternativen darstellen. An der Bewertung ist er als Experte seines eigenen Lernerfolgs mit Rede- und Vorschlagsrecht beteiligt.
Zusammenfassung
Obwohl die vier Beispiele ganz unterschiedliche Formen von Leistungsbewertung betreffen, haben sie eine Tendenz gemeinsam: Es wird versucht, typische berufliche Handlungen möglichst in ihrer Gesamtheit zum Gegenstand der Beurteilung zu machen. Die bedeutet zugleich, den Freiraum der Auszubildenden bei der Aufgabenbewältigung im Vergleich zu herkömmlichen Prüfungsverfahren erheblich zu erweitern. Hinsichtlich der hierbei auftretenden Bewertungsprobleme besteht noch erheblicher Forschungs- und Erprobungsbedarf. Der dürfte sich aber lohnen, denn neue Entwicklungen und Ansätze (z.B. "Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz") zu propagieren und mehr oder weniger unverbindlich einzuführen, ist etwas anderes, als solche Forderungen und damit eine Neuorientierung in der Berufsbildung durch veränderte Beurteilung und Prüfungen tatsächlich zu manifestieren bzw. einzulösen.